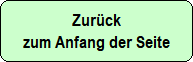|
Schicksale
Veröffentlichungen im Jahre 2016
Aus der SZ/BZ vom 30.12.2016
Hilferuf eines Familienvaters
Von Renate LĂŒck
Einen der Weihnachtswunschzettel, die im Sozialamt und im Jobcenter auslagen, fĂŒllte Achim K. mit einem Hilferuf fĂŒr seine Familie aus.
âLiebes Nachbarn-in-Not-Team,
meine Frau hat Lungenkrebs und nun auch wieder Metastasen im Kopf. Sie hatte im Februar schon eine Operation, bei der die Metastasen zum gröĂten Teil entfernt werden konnten. Ich bin der Betreuer meiner Frau. Wir bekommen beide Leistungen vom Jobcenter, weil wir beide krank sind.“ Der 16-jĂ€hrige Sohn der Familie ist sehr praktisch veranlagt und schmeiĂt den ganzen Haushalt. Er begleitet den Vater auch zu den Behörden. Er liebt seine Eltern heiĂ und innig und tut alles fĂŒr seine Mutter. Dabei hat er selbst Probleme. Er kommt in der Schule in Mathematik nicht gut mit.
âBei uns ist das Geld sehr knapp“, schreibt der Vater. âWir haben viele Ausgaben: die Medikamente fĂŒr meine Frau, Nachhilfe fĂŒr meinen Sohn und so weiter. Deshalb wĂŒrden wir uns ĂŒber eine Spende sehr freuen. Ich möchte meinem Sohn neue Kleidung kaufen und auch meiner Frau etwas Schönes schenken. Vielen lieben Dank und liebe GrĂŒĂe! Achim K.“
Die Hilfsorganisation erfĂŒllte diesen Weihnachtswunsch.
Aus der SZ/BZ vom 24.12.2016
Licht am Ende des Tunnels
Von Renate LĂŒck
Es gibt mehrere GrĂŒnde, warum jemand aus der Lebensbahn geschleudert wird. Bei Rolf M. war es die Scheidung von seiner Frau. Das kam ihn teuer.
Er musste die Wohnung verlassen und landete auf der StraĂe. Vom Gehalt seines zeitlich begrenzten Werkvertrag-Jobs konnte er die Scheidungskosten und den Unterhalt fĂŒr Frau und Kinder nicht bezahlen und machte Schulden. Eine Sozialarbeiterin in der Diakonie half ihm. Er bekam ein Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft und bezog Arbeitslosengeld II. Langsam, langsam stieg sein Mut und er machte einen BusfĂŒhrerschein. Damit fand er eine neue Arbeitsstelle und hatte eine Wohnung in Aussicht. Das Problem war allerdings, dass er gleich vom ersten Gehalt den Unterhalt fĂŒr die beiden Kinder ĂŒberweisen musste. Da lieĂ das Jugendamt nicht mit sich reden.
Vom Rest konnte er aber keine Möbel und HaushaltsgerĂ€te kaufen. Also zog er erst einmal in die leere Wohnung. Dies war fĂŒr ihn ziemlich frustrierend, denn er bemĂŒhte sich sehr, aus der verfahrenen Situation herauszukommen. Deshalb bat die Sozialarbeiterin âNachbarn in Not“ um Hilfe. Der Verein gab einen Zuschuss fĂŒr das Nötigste. Und sein Chef unterstĂŒtzt ihn auch. Also (Weihnachts-)Licht am Ende des Tunnels!
Aus der SZ/BZ vom 20.12.2016
Wackelig auf den Beinen
Von Renate LĂŒck
Was alles passieren kann, wenn man wackelig auf den Beinen ist. Margret M. stĂŒrzte und zerbrach dabei ihre Zahnprothese. Nun ist guter Rat teuer.
Die 50-jĂ€hrige Margret M. leidet schon seit ĂŒber zwanzig Jahren an psychischen als auch an körperlichen Erkrankungen, wie Epilepsie und Durchfall. In ihrem Kopf herrscht ein so groĂer Druck, dass sie ein Röhrchen, einen sogenannten Shunt, eingesetzt bekam, damit das Wasser abgeleitet wird. Sonst bestĂŒnde die Gefahr, dass sie einfach umfĂ€llt und stirbt. Die Epilepsie kommt von diesem Druck. Sie lebt in einer betreuten Wohngemeinschaft zusammen mit ihrem Mann, den sie in der Behindertenwerkstatt kennengelernt hat. Dort arbeitet sie an drei Tagen in der Woche maximal vier Stunden, aber mehr um eine Tagesstruktur zu haben, als dass sie wirklich etwas produzieren könnte. Ihr Mann schafft sechs Stunden. Sie werden vom Fahrdienst abgeholt und wieder heimgefahren.
Zu Hause kocht sie sich Kaffee und bewegt sich den Rest des Tages vorsichtig in der Wohnung. Trotzdem ist sie kĂŒrzlich im Bad aufs Waschbecken gestĂŒrzt, als die wieder einen epileptischen Anfall hatte. Dabei zerbrach ihre Zahnprothese. Der Eigenanteil der Reparaturkosten ĂŒbersteigt massiv ihr Budget, das allerdings 25 Euro zu hoch ist, um einen HĂ€rtefall-Antrag stellen zu können. Da bat der betreuende Sozialarbeiter âNachbarn in Not“ um Hilfe, denn ohne ZĂ€hne kann Margret M. nicht einmal PlĂ€tzchen essen. Das neue Jahr sollte aber doch etwas unbeschwerter beginnen.
Aus der SZ/BZ vom 17.12.2016
Zwei Katastrophen auf einmal
Von Renate LĂŒck
Wenn es einmal klemmt, kommen meist noch weitere Probleme dazu. Dass durch die Krankheit eines Kindes der Vater den Arbeitsplatz verliert, ist aber doch dramatisch.
Familie P. hat drei kleine Kinder. Kurz nach der Geburt des jĂŒngsten erkrankte die dreijĂ€hrige Andrea an LeukĂ€mie. Die Familie musste zuerst zwei Wochen stationĂ€r in der Klinik in TĂŒbingen bleiben. Dann durfte sie nach Hause und die Kleine musste nur bei Fieber oder starken Schmerzen ein bis zweimal die Woche hin gefahren werden. Aber Waltraud P. musste auch noch einmal ins Krankenhaus. So versorgte Michael P. die Kinder. Er hatte allerdings gerade eine neue Stelle angefangen und war noch in der Probezeit. Wegen dieser Fehlzeiten wurde er entlassen. Die Sachbearbeiter in der Personalabteilung und im Jobcenter bekamen diesen Wechsel aber nicht so schnell auf die Reihe, sodass die Familie vorĂŒbergehend gar kein Geld erhielt.
Die Sozialarbeiterin im Rathaus hĂ€ndigte ihr Gutscheine aus, damit sie Essen und Windeln kaufen konnte und gab ihr Geld fĂŒr die Fahrt zum Krankenhaus. Nach der Behandlung und durch die Medikamente schlief das kranke Kind regelmĂ€Ăig ein und kippte aus dem zu kleinen Kindersitz. Ein neuer ĂŒberstieg jedoch die Möglichkeiten der Familie bei weitem. Und als ob dieses Dilemma nicht reichte, kam noch eine saftige Telefonrechnung. Da war der Traum von einem WĂ€schetrockner in weite Ferne gerutscht. âNachbarn in Not“ half mit einem Zuschuss, damit die Weihnachtszeit ein bisschen heller wird.
Aus dern SZ/BZ vom 14.12.2016
Zukunft sieht nicht rosog aus
Von Renate LĂŒck
Gut, dass Kinder zwei Eltern haben, die sich um sie kĂŒmmern können. Schlecht aber, wenn der Vater arbeitslos und krank ist und die Mutter nachts arbeiten gehen muss.
Paul Z. war Lagerarbeiter, musste aber wegen starker RĂŒckenschmerzen seine Arbeit aufgeben. Nun bekommt er Arbeitslosengeld und muss nach der Reha eine Umschulung machen. Doch fĂŒr welchen Beruf? Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus, was ihn ganz kribbelig macht. Monika Z. hĂ€lt die Familie zurzeit ĂŒber Wasser. Sie arbeitet im Moment als GebĂ€udereinigerin in einem Sportpark auf 450-Euro-Basis. Der Dienst beginnt um 24 Uhr und dauert eine bis eineinhalb Stunden an sechs Tagen in der Woche.
Ihr Problem ist, dass sie zwar mit einem öffentlichen Nahverkehrsmittel hinkommt, aber nicht mehr zurĂŒck. Da fĂ€hrt kein Bus und keine Bahn in ihre Richtung. Sie hatte ein altes Auto. Das hatte aber einen Motorschaden, weshalb sich die Reparatur nicht mehr lohnte. Sie braucht dringend ein anderes Vehikel, sonst verliert sie ihre Arbeit. Nun fand sie ein Auto, Baujahr 1997 und viele Kilometer auf dem Tacho, aber der TĂV ist erst nĂ€chstes Jahr. Wegen der angespannten finanziellen Situation kann sie sich nicht einmal das leisten. Deshalb bat sie um Hilfe, um das GefĂ€hrt kaufen zu können. âNachbarn in Not“ gab einen Zuschuss, damit Weihnachten wenigstens eine ganz kleine Gans auf dem Tisch steht.
Aus der SZ/BZ vom 10.12.2016
Die Gesundheit ist im Eimer
Von Renate LĂŒck
Julius R. ist einer der Schwaben, die sich in Berlin öfter mal einen RippenstoĂ oder eine blutige Nase geholt haben: Er war Bodyguard und TĂŒrsteher. Als seine Eltern starben, ging er nach Hause zurĂŒck.
Viel Geld ist von seiner Arbeit nicht ĂŒbrig geblieben. Der 60-JĂ€hrige ist inzwischen zu 90 Prozent schwerbehindert und lebt von Grundsicherung. Die Gesundheit ist im Eimer. Er ist kurzatmig und braucht wegen seiner Schlafapnoe - â85 Aussetzer pro Minute“ - nachts und beim MittagsschlĂ€fchen eine Maske und ein SauerstoffgerĂ€t. FĂŒnf- oder sechsmal hat er sich den Arm gebrochen, was er auf seine Medikamente zurĂŒckfĂŒhrt, denn Diabetes und Asthma hat er auch noch. Er ist schwer auf den Beinen und hatte mehrere BandscheibenvorfĂ€lle. Mit all diesen Schmerzen schlief er sehr schlecht auf seinen durchgelegenen, 13 Jahre alten Matratzen. Der 110 Kilo schwere Mann schlĂ€ft nĂ€mlich auf zwei Matratzen, weil er seit seiner Bundeswehrzeit Angst hat, aus dem Bett zu fallen. Damals erlebte er wohl viel Spott von seinen Zimmerkollegen. Nun suchte er selbst nach geeignetem Bettzeug und bat um einen Zuschuss. Den Rest wĂŒrde sein Freundeskreis aufbringen. âNachbarn in Not“ half und Julius R. bedankte sich herzlich. âDie Schmerzen beim Liegen haben sich sehr verbessert. Jetzt kann ich wieder durchschlafen.“
Aus der SZ/BZ vom 2.12.2016
Leben am Minimum
Von unserer Mitarbeiterin Renate LĂŒck
âSehr geehrter Herr R., hiermit kĂŒndigen wir Ihnen das ArbeitsverhĂ€ltnis zum 30.9.2016. ....Wir bedauern diese Entscheidung sehr, bedanken uns fĂŒr Ihre Mitarbeit und wĂŒnschen Ihnen auf Ihrem weiteren Weg und fĂŒr Ihre berufliche Zukunft alles Gute.“
Da kommt Freude auf, besonders wenn seine Frau, die im selben Betrieb arbeitet, auch so einen Brief erhĂ€lt. Hans R. war seit dem FrĂŒhjahr krank, was vielleicht an der schweren, aber schlecht bezahlten Arbeit lag. Seine Frau hatte einen 450-Euro-Job und bekommt deshalb kein normales Arbeitslosengeld. âFinanziell sieht es nun sehr schlecht aus, vom psychischen Zustand gar nicht zu reden“, schreibt die sie begleitende Sozialarbeiterin. Zu Hause ist der KĂŒhlschrank kaputt und lĂ€sst sich nur noch mit Klebeband verschlieĂen. Zum Ansparen von Anschaffungen hat es nie gereicht. Alles im Haushalt ist ziemlich schlicht und es fehlt an vielem.
Am schlimmsten dran ist jedoch der behinderte Sohn, der dringend ein neues Bett und eine stabilere Matratze braucht. Er ist stark pflegebedĂŒrftig, braucht Windeln und muss in lebensbedrohlichem Zustand immer wieder ins Krankenhaus. In dieser Zeit bekommt die Familie kein Pflegegeld, was die Eltern jedes Mal in Angst und Schrecken versetzt, dass am Monatsende kein Geld fĂŒrs Essen da ist, denn sie haben noch ein kleineres Kind. Es ist ein Leben am Minimum. âSich etwas zu gönnen, war nie drin“, erzĂ€hlt die Sozialarbeiterin, die an âNachbarn in Not“ schrieb. Die Hilfsorganisation ĂŒberwies einen Betrag, der fĂŒrs Erste helfen soll, damit vielleicht an den Festtagen ein bisschen Freude aufkommen kann.
Aus der SZ/BZ vom 29.11.2016
Endlich neue Matratzen
Von Renate LĂŒck
Auch wenn der Mann Arbeit hat, reicht das Geld bei manchen Familien vorn und hinten nicht. Das hÀngt an verschiedenen Dingen.
Christian B. hat einen guten Beruf, verdient aber gerade doppelt so viel, wie die Miete kostet. Dann ist der Rest fĂŒr eine Familie mit drei Kindern nicht mehr sehr ĂŒppig. Sie lebt praktisch an der Armutsgrenze. âIch möchte ja arbeiten gehen, wĂŒrde auch putzen“, sagt Brigitte B., âaber es ist alles voll. Und dann sollte ich kommen, wenn ich meine Kleine vom Kindergarten abholen muss. Das will ich nicht.“ Die Kinder gehen ihr ĂŒber alles. Da sie selbst keine ordentliche Ausbildung machen konnte, legt sie groĂen Wert darauf, dass die Kinder pĂŒnktlich zur Schule gehen. Die Ălteste ist auf der Werkrealschule und lernt gut. Sie hĂ€tte auch gern Gitarrenunterricht, aber die Musikschule ist trotz Berechtigungskarte zu teuer fĂŒrs Budget. Es wĂ€re der Familie eine finanzielle Erleichterung, wenn sie die Fahrkarte zur Schule vom Landratsamt bezahlt bekĂ€me. Doch dazu fehlen 200 Meter zwischen Wohnung und Schule. Und laufen ist denn doch zu weit, zumindest im Winter.
Bis jetzt schlafen alle auf alten Matratzen, die Eltern auf denen, die sie sich zur Hochzeit vor 16 Jahren gekauft haben. Die zwei jĂŒngeren Kinder hĂ€ngen zum Baby- und Kinderbett heraus und die Ălteste schlĂ€ft auf dem Boden. Christian und Brigitte B. hatten beide schon einen Bandscheibenvorfall. Nun wollte Brigitte B. mit dieser Misere Schluss machen und bestellte zu Weihnachten fĂŒr die Kinder richtige Betten und Matratzen, nachdem âNachbarn in Not“ einen Zuschuss zusagte.
Aus der SZ/BZ vom 26.11.2016
Mein ganzes Leben war schwierig
Von Renate LĂŒck
Die Antragszettel der Sozialarbeiterinnen enthalten oft nur wenige Stichpunkte zur schlimmen Situation ihrer Kunden. Wenn man nachfragt, sprudeln diese nur so heraus.
âJetzt bin ich fast achtzig, aber mein ganzes Leben war schwierig“, sagt GĂŒnter P. zum Beispiel. Er ist bei den GroĂeltern aufgewachsen, weil die Mutter frĂŒh starb. Vor einigen Jahren hatte er Knochentuberkulose und lag ein Jahr lang eingegipst im Krankenhaus. Dann erhielt er eine Vorladung der VertrauensĂ€rztin, die ihn sofort zum Kardiologen schickte, weil die Herztöne beĂ€ngstigend waren. Es folgte eine Operation, bei der ihm vier BypĂ€sse eingesetzt wurden, und da einer gleich wieder verstopft war, bekam er noch einen Stent.
Dann half er einem Nachbarn im Garten. Da flutschte ihm ein Ast ins Auge. Nun hat er nur noch eins. Er hĂ€ngt den ganzen Tag am SauerstoffgerĂ€t, das ihn AnfĂ€lle ĂŒberleben lĂ€sst. Der Rollator steht im Flur. âIch kann doch nicht mehr laufen. Die Knie knicken immer ein. Mein Arzt sagte zu mir: Sie sind nur noch ein Viertelmensch. Wenn Sie rauchen wĂŒrden, wĂ€ren Sie schon tot.“
Dem Sozialamt fiel das Ehepaar, das von Grundsicherung lebt, dadurch auf, dass es verzweifelte Briefe schrieb, Da war der KĂŒhlschrank kaputt, der aber nun angespart werden muss, wie andere ElektrogerĂ€te auch. Aber GĂŒnter P. muss die Privatrezepte seines Arztes schon selbst bezahlen und zur Miete auch noch einen Teil. Jetzt hat er Angst, dass seine Frau dement wird. âDann ist alles aus.“
Gefreut hatten sich die beiden, als sie zum ersten Mal auf die Altenliste kamen und âim vergangenen Jahr, nach 13 Jahren mal wieder Weihnacht feiern konnten mit Christbaum und Entenbraten“, schrieb er an Dr. Roswitha Seidel und ihr Team. Am Telefon sagt er: âSonst haben wir Brathering und Röstkartoffeln gegessen, um zu sparen.“ Der Brief an die Vorsitzende von âNachbarn in Not“ geht weiter mit: âIhre neuerliche Hilfe wird uns helfen, ein paar Wintersachen anzuschaffen. Es ist alles ein bisschen wie ein schöner Traum.“ Der erste Satz dieses Briefes heiĂt: âDanke, Danke, Danke - mehr fĂ€llt mir auch heute noch nicht ein. Es ist absolut groĂartig zu wissen, dass wir sind trotz unseres Alters noch nicht vergessen sind.“
Aus der SZ/BZ vom 29.10.2016
Von einem Tief in s nÀchste
Von Renate LĂŒck
Es gibt grausliche Geschichten, in die man sich nur schwer hineinversetzen mag. Petra M. zum Beispiel schleuderte von einem Tief ins nÀchste.
Seit vier Jahren ist die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin arbeitslos. Durch diesen Zustand, das frĂŒhere Mobbing und âtausend SchicksalsschlĂ€ge“ wurde sie psychisch so krank, dass sie in eine Klinik kam. Auch finanziell lebt sie nun am Rande der Gesellschaft, denn ihre Erwerbsminderungsrente reicht nicht fĂŒr die Miete einer brauchbaren Wohnung. âMein Job war sehr stressig“, erzĂ€hlt die 45-JĂ€hrige. âIch hatte einen Burnout. Dazu kam der plötzliche Tod meiner Eltern, die mir jederzeit zur Seite gestanden hatten, und die Trennung von meinem drogenabhĂ€ngigen Freund, der immer gewalttĂ€tiger wurde“, erzĂ€hlt sie. Als sie aus der Klinik entlassen wurde, zog sie in eine kleine, dunkle und feuchte Wohnung im Keller eines Hauses. Noch feuchter wurde es durch einen Wasserrohrbruch in der Wohnung darĂŒber. Die WĂ€nde ihrer Behausung ĂŒberzogen sich mit grĂŒnem und schwarzen Schimmel, der mit der Zeit auch auf die Möbel ĂŒberging. Der Sozialarbeiter, an den sich Petra M. wandte, war entsetzt: âMan konnte kaum Luft holen.“ Kein Wunder, dass Petra M. zunehmend Hautausschlag und Nasenbluten bekam und an körperlichen Schmerzen litt. Ein Gutachter bestĂ€tigte, dass nicht die Mieterin schuld war an dieser desolaten Situation. Es folgten Gerichtsurteile ĂŒber zugestandene MietkĂŒrzungen. Allerdings behielt Petra M. bald die ganze Miete ein, weil die SpĂŒlung in der Toilette nicht ging und die HaustĂŒr sich so verzogen hatte, dass man sie nur mĂŒhsam schlieĂen konnte. Dies fĂŒhrte letztlich zur RĂ€umung der Wohnung.
AnschlieĂend lebte Petra M. in einer Obdachlosenwohnung der Stadt. Mit ihren finanziellen Mitteln fand sie keine Wohnung, âdenn viele Menschen stehen auf der Warteliste des Wohnungsamtes.“ SchlieĂlich fand sie ein Zimmer in einer Wohnung, deren Toilette und Dusche sie mit drei MĂ€nnern teilen muss. Sie musste schnell umziehen. Doch zweimal eine Spedition beauftragen, konnte sich Petra M. nicht leisten. Dazu kam, dass sie neue Möbel brauchte. âNachbarn in Not“ half beim Notwendigsten. Petra M. jetzt: âZur Zeit bin ich schachmatt und fĂŒhle mich einsam. Ich wĂŒrde gern halbtags arbeiten, wenigstens dreimal in der Woche, um wieder an Geld zu kommen fĂŒr eine anstĂ€ndige Wohnung.“
Aus der SZ/BZ vom 1.10.2016
Die Abschlussfeier ist gerettet
Von Renate LĂŒck
Jetzt geht die Schule wieder los, aber fĂŒr manche war der Abschluss des vorigen Schuljahrs schon schwierig. Nicht wegen der Noten, sondern wegen der Finanzen.
Lena B. beendete die Hauptschule und es stand eine Abschlussfeier an. Die kostete allerdings Eintritt - einen Betrag, der das Taschengeld eines Kindes von Hartz-IV-Beziehern ziemlich reduziert. Der Wunsch, dass ihre Mutter und die jĂŒngere Schwester ebenfalls teilnehmen, stellte die alleinerziehende Michaela B. vor erhebliche Schwierigkeiten. Sie hĂ€tte der Tochter auch gern ein neues Kleid zu diesem Anlass gekauft, doch das ĂŒberstieg ihr Budget bei weitem. Das Jobcenter zahlt solche Extras nicht und selbst zu nĂ€hen, ging auch nicht, weil ihre NĂ€hmaschine kaputt ist, eine neue unerÂschwinglich.
Michaela B. lebt gerade in Scheidung und zusĂ€tzlich zu diesen Problemen wurde die Miete drastisch erhöht, weil die Wohnung verkauft werden soll. Das Jobcenter zahlt nur ein halbes Jahr die erhöhte Miete, dann muss eine andere Wohnung im Rahmen des Hartz-IV-Satzes gefunden sein. Eine absolute Katastrophe fĂŒr alle, die dies trifft, denn in den WohnungsĂ€mtern sind die Wartelisten fĂŒr eine Sozialwohnung lĂ€nger als die Baugesuche im Bauamt. Da der Vater der Kinder auch nicht helfen kann, ging Michaela B. zum Sozialamt und fragte um Rat. Die Sozialarbeiterin ihrerseits bat âNachbarn in Not“ um schnelle Hilfe, damit die Situation gerettet werden könnte. Sie konnte und Lena probierte ihr neues Kleid vor GlĂŒck jeden Tag an. Die Mutter bedankte sich sich herzlich.
Aus der SZ/B Z vom 24.8.2016
Wenn plötzlich das Licht ausgeht
Von Renate LĂŒck
âIhre Energieversorgung“ steht auf dem Briefkopf der EnBW-Mahnungen. Wer StromÂschulden hat, aus welchem Grund auch immer, verliert ganz schnell das Vertrauen in seinen Energieversorger. Der schickt nĂ€mlich monatlich einen Inkasso-Beauftragten, was jedes Mal zusĂ€tzlich 90 Euro kostet. Im Moment ist dies das hĂ€ufigste Problem fĂŒr âNachbarn in Not“.
Die geschiedene Lena B. zum Beispiel, die mit Teilzeitarbeit, Nebenjob und Kindergeld mit ihren zwei Kindern knapp ĂŒber die Runden kommt, ĂŒberweist ihre Abschlagszahlungen pĂŒnktlich. Sie bekam aber im Juni eine Nachschlagsforderung, die ihre Möglichkeiten ĂŒbersteigt. Die letzte Zahlungsaufforderung vor der Sperrung enthĂ€lt den Satz: âBitte bezahlen Sie sofort den Betrag von 538 Euro. Ansonsten beauftragen wir Ihren Netzbetreiber damit, Ihre Energielieferung einzustellen. Das kostet Sie einschlieĂlich der Wiederinbetriebnahme mindestens 197,10 Euro.“ Ratenzahlung wurde ihr nicht zugestanden. Deshalb bat die Schuldnerberaterin âNachbarn in Not“ um einen Zuschuss. Sie schlug ihrer Klientin aber auch vor, sich an einen Energieberater zu wenden, der den Stromfresser ausfindig machen soll.
Da dies beileibe kein Einzelfall ist, interessierte sich sogar das SWR-Fernsehen dafĂŒr und nahm ein Interview mit Lena B. auf. Seit Januar kamen neun AntrĂ€ge von verschiedenen Ămtern im Landkreis bei âNachbarn in Not“ an. Die Hilfsorganisation bemĂŒht sich, das Abstellen des Stroms zu verhindern, weil es sonst ja noch teurer wird. Auch die Stadtwerke sind bei Ratenzahlung sehr zurĂŒckhaltend. Bei einer Familie, die einen gröĂeren Betrag nachzuzahlen hatte, verlangten sie Mindestraten von 350 bis 400 Euro. Familien, die nur geringere BetrĂ€ge aufbringen könne, erhalten trotzdem weiterhin Mahnungen und Androhungen, dass der Strom abgestellt wird. Auch wenn jemand einen MĂŒnzzĂ€hler installiert bekommt, ihn aber aus Geldmangel nicht fĂŒttern kann, steht er ohne Strom da.
Birgit Knaus von der Diakonie ist sauer, denn auch sie und ihre Kolleginnen erreichen keine Erleichterungen fĂŒr ihre Klienten. Selbst wenn Behinderte oder Kinder im Haushalt sind, wird keine RĂŒcksicht genommen. Da heiĂt es: Dann muss das Kind halt Hausaufgaben machen, wenn es noch hell ist. âDie meisten unserer Klienten bezahlen den teuersten Grundversorgungstarif und kommen da nicht raus. Auch fĂŒr Ratenvereinbarungen werden GebĂŒhren verlangt“, erklĂ€rt sie. âAber die Klienten sind nicht die richtigen Gegner. Es ist ein gesellschaftliches Problem, das bei den Strompreisen anfĂ€ngt, ĂŒber die Niedrigeinkommen weitergeht und bei der Frage der sozialen Verantwortung von öffentlich-rechtlichen Grundversorgungsunternehmen endet.“ Wenn die Ămter in den geschilderten Notsituationen nicht helfen können, weil ihre starren Vorschriften es nicht erlauben, istâNachbarn in Not“ die letzte Rettung.
Aus der SZ/BZ vom 28.11.2016.
Wenn der Friseur zum Luxus wird
Von Renate LĂŒck
âBei aller Problematik, mit der unser Land zur Zeit konfrontiert ist, dĂŒrfen wir nicht die Not in unserer Umgebung vergessen“, sorgt sich die Vorsitzende von âNachbarn in Not“, Dr. Roswitha Seidel, nach ihrer Seniorentour vor Weihnachten. âEs sind in der Regel Frauen, die die Altersarmut trifft“, bestĂ€tigt SozialpĂ€dagogin Betina Hartig im Haus der Diakonie in Böblingen.
âFrauen, deren MĂ€nner die Hauptverdiener waren - die die Kinder groĂgezogen und höchstens in schlecht bezahlten Jobs gearbeitet haben. Das Modell funktioniert, solange es gut geht. Trennen sich die Eheleute jedoch, bekommen die Frauen im Alter eine Mini-Rente.“ Selbst mit Grundsicherung sei es so wenig, dass sie mit GlĂŒck noch die Miete und das Notwendigste bezahlen können. Brauchen sie eine kleinere Wohnung, suchen sie genauso verzweifelt, wie allen anderen mit schmalem Budget. Christine Jourdan im Sindelfinger Sozialamt weiĂ noch eine Gruppe: âFrauen, deren MĂ€nner selbststĂ€ndig waren und denen sie ohne Gehalt halfen, haben oft ihre Altersversorgung vernachlĂ€ssigt - sei es, weil das GeschĂ€ft gut lief oder weil man das Geld der RentenbeitrĂ€ge brauchte. Oft hat sich die Frau sogar ihre bis dahin angesparte Rente auszahlen lassen.“
âEs rĂŒhrt mich immer sehr, die Frauen drehen buchstĂ€blich jeden Cent um“, sagt Hartig. Eine isst meist Zwieback zum verdĂŒnnten Joghurt und manchmal GemĂŒseeintopf als Hauptgericht. âSchweineschnitzel mit PĂŒrree und Erbsen ist fĂŒr mich wie Weihnachten“, erzĂ€hlte die 91-JĂ€hrige. Schuhe reparieren lassen sei aber schwierig. âSie sind sehr bescheiden und schĂ€men sich, ins Amt zu kommen“, bestĂ€tigt Hartig. âDann erzĂ€hlen sie von frĂŒher, wie gut es geplant war.“ Kinder, die genug verdienen, unterstĂŒtzen die Mutter. Doch manchmal wohnen sie weit  weg und der Mutter sei es peinlich, um etwas zu bitten. weg und der Mutter sei es peinlich, um etwas zu bitten.
Bild LĂŒck. Stand von Nachbarn in Not am Sindelfinger Weihnachtsbasar
Etwa achtmal im Jahr komme eine Frau zu ihr, deren Mann keine nennenswerte Lebensversicherung hinterlieĂ. Die Witwenrente reiche auch mit Grundsicherung nicht, um Winterkleidung oder feste Schuhe zu kaufen. Sommerkleidung gibt es im Diakonieladen. Aber etwas richtig Warmes oder passende Schuhe seien selten da. âIch kann GutÂscheine fĂŒr den Diakonie- und den Tafelladen geben“, sagt Betina Hartig. Was sie nicht hat, sind Kino- oder Theaterkarten. Wer im Umland wohnt, könne sich auch den Bus in die Stadt nicht leisten. âDamit sind sie ausgegrenzt. Sie können nicht mal eben mit der Freundin nach Stuttgart zum Weihnachtsmarkt fahren und einen GlĂŒhwein trinken. Mir wird immer wieder bewusst, woran es fehlt: an den normalen Begegnungen und GesprĂ€chen.“
Die Frauen haben auch alle kein Auto. âEs ist Ironie: Selbst mit Hartz IV darf man ein Auto haben, kann aber weder die Versicherung noch den Sprit bezahlen geschweige denn Reparaturen. Wir wohnen in einer teuren Gegend.“ Luxus sei ebenso ein Friseurbesuch - âSie sparen darauf!“ - oder das Thermalbad, das ihnen gut tĂ€te. Die Brille zahlt die Krankenkasse nicht, die fast jeder im Alter brauche. âDas geht nur durch Spenden. Wenn es ‘Nachbarn in Not’ nicht gĂ€be, wĂ€re das alles nicht möglich.“
Aus der SZ/BZ von 13.6.2016
Das Geld reicht nicht fĂŒr einen Regenmantel
Von Renate LĂŒck
Hier kam wieder alles zusammen: Krankheiten und Probleme in der Familie. Und dann reichte das Geld nicht fĂŒr einen Regenmantel.
Gerda L., gelernte Hotelfachfrau, arbeitete vormittags in einer Kantine und fuhr nach dem Mittagessen 70 Kilometer zu ihrem eigenen Restaurant. âDa war ich alles: Köchin, Putzfrau und Bedienung.“ Ihr Mann, in der Industrie angestellt, machte ihr in seiner Freizeit die Buchhaltung. Bis sie feststellte, dass er Kredite und Geschenke fĂŒr seine Freundinnen mit dem Gewinn aus ihrem GeschĂ€ft bezahlte. Sie ging pleite und knabbert an diesen Schulden noch heute.
Seitdem plagen sie Krankheiten, die ein Gewerbe oder andere BeschĂ€ftigung nicht mehr zulassen. Die WirbelsĂ€ule ist total verkrĂŒmmt und die Bandscheiben abgenutzt, so dass die 62-JĂ€hrige kaum noch laufen kann. Einkaufen ist ganz schlecht, weil sie beim Martins-LĂ€dle im GedrĂ€nge Schlange stehen mĂŒsste. Sie kann sich gerade noch Essen machen. Liebe Nachbarinnen schauen nach ihr, wenn das Licht nicht brennt.
Zu alledem kommen UnpĂ€sslichkeiten, die man nicht sieht, wie Schwerhörigkeit, Schlafapnoe und Tics, ein nervöses Zucken, dass andere fĂŒr schlechte Angewohnheiten halten. Durch die vielen Medikamente nahm sie so zu, dass ihre Kleidung nicht mehr passte, als der Arzt sie zur Kur schicken wollte. Da war âNachbarn in Not“ wieder der letzte Anker. Gerda L. bat schon ab und zu um Hilfe, wenn unverhoffte Rechnungen eintrudelten. âIch bin ‘Nachbarn in Not’ und allen lieben Spendern so unendlich dankbar. Ohne sie wĂ€re ich tot“, sagt sie am Telefon. Die Vorsitzende Dr. Roswitha Seidel setzte Gerda L. auf die Seniorenliste, so dass sie zweimal im Jahr bei den Besuchen einen kleinen Obulus erhĂ€lt.
Aus der SZ/BZ vom 4.4.2016
Kein Amt kann helfen
Von unserer Mitarbeiterin Renate LĂŒck
So eine schreckliche Geschichte, aber kein Amt kann helfen. Wenn es âNachbarn in Not“ nicht gĂ€be, stĂ€nden zwei junge Menschen buchstĂ€blich auf der StraĂe und hĂ€tten nichts zu essen.
Der 19-jĂ€hrige Maximilian B. und seine 18-jĂ€hrige Schwester Michaela gehen in die Schule und wollen im nĂ€chsten Jahr und 2018 Abitur machen. Vor 15 Jahren verlieĂ ihr Vater die Familie, was die Mutter in tiefe Depressionen stĂŒrzte. Sie vergrub sich regelrecht und hatte kaum mehr Kontakte nach auĂen. Die Kinder mussten einkaufen gehen und die nötigen Besorgungen machen. Sie hatten dementsprechend wenig Zeit und Lust, die Freizeit mit Klassenkameraden zu verbringen, weshalb sie von ihnen geÂhĂ€nselt wurden. Trotzdem arbeiteten sie sich hoch und wechselten fĂŒr die Oberstufe die Schule, wo sie gut mitkommen. Maximilian möchte studieren, Michaela weiĂ noch nicht, was sie anstreben soll.
Plötzlich starb die Mutter im Beisein ihrer Kinder. Vorher hatte sie ihnen gesagt: âWenn mir je etwas passiert, wendet euch an den Erziehungsbeistand.“ Der hatte sich frĂŒher im Rahmen der Jugendhilfe um sie gekĂŒmmert und ihnen praktische Dinge beigebracht, wie die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen oder Rechnungen zu bezahlen. Und er hatte immer noch ein bisschen Kontakt zu den ihnen. So nahm er die beiden völlig verstörten Jugendlichen erst einmal bei sich auf. Doch auf die Dauer ging das nicht. So kamen sie zu einer Kurzzeitpflegemutter. Inzwischen regelte das Jugendamt alles Nötige, beantragte Bafög und Halbwaisenrente und sprach mit dem Vermieter der Wohnung. Er war bereit, die beiden weiter drin wohnen zu lassen, wenn die Finanzierung klar sei.
Das Jobcenter signalisierte, dass die Miete weiterhin bezahlt wĂŒrde. Max und Michaela zogen wieder ein. Doch nun verweigert das Jobcenter die weitere Finanzierung der Wohnung sowie die âHilfe zum Lebensunterhalt“ mit dem Verweis auf den von den beiden VolljĂ€hrigen gestellten Bafög-Antrag, der Vorrang gegenĂŒber den Leistungen des Jobcenters darstelle. âDoch bis dieser Antrag vollstĂ€ndig bearbeitet werden kann, vergehen nicht selten einige Wochen bis Monate. Bis dahin stehen die Jugendlichen mittellos da, denn das Jobcenter lehnt auch die finanzielle Vorleistung ab“, sagt der Sozialarbeiter, der die beiden begleitet. Das Amt fĂŒr Ausbildungsförderung, das den BaföG-Antrag stellte, darf auch keinen Kredit geben. Es muss den Vater suchen, der Kindergeld beantragen soll, es sei denn, er wĂ€re unauffindbar. Doch die fleiĂige Amtsfrau ermittelte ihn, obwohl er inzwischen einen anderen Namen hat. und hofft, dass er sich kooperativ zeigt.
Die Jugendhilfe kann ebenfalls keine finanzielle UnterstĂŒtzung gewĂ€hren, weil die Voraussetzungen fĂŒr Betreutes Jugendwohnen fehlen. Die Sachbearbeiter und sogar die Leiter der beteiligten Ămter diskutierten die Situation, doch âStets standen Vorschriften und gesetzliche Bestimmungen einer schnellen und unbĂŒrokratischen Lösung im Weg“, berichtet der Sozialarbeiter, der schlieĂlich âNachbarn in Not“ um Geld bat, damit die beiden wenigstens Lebensmittel kaufen können. Ein neuer Erziehungsbeistand und eine SozialpĂ€dagogin begleiten sie nun durch diese schwierige Zeit.
Aus der SZ/BZ vom 31.3.2016
Mit Brille kann man besser gucken
Von Renate LĂŒck
Viele Menschen spenden fĂŒr âNachbarn in Not“. Man kann auch hilfreich sponsern. Henning Mezger, Augenoptikermeister in der Planie, hilft mit seinem Einsatz und preisgĂŒnstigen Brillen.
1973 haben seine Eltern das AugenoptikgeschĂ€ft in der Planie gegrĂŒndet, seit 1999 ist Henning Mezger Inhaber. Warum unterstĂŒtzt er âNachbarn in Not“? âDas ist einfach zu beantworten. Wenn es einem gut geht, kann man auch helfen. Das ist eine Grundphilosophie“, antwortet Henning Mezger spontan. Nach den vielen Zeitungsartikeln habe er sich direkt an die GeschĂ€ftsstelle gewandt und gesagt: âIch kann helfen, wenn Bedarf besteht.“ Was fĂŒr eine Frage! Dr. Roswitha Seidel, die Vorsitzende, regt sich immer besonders auf, wenn Menschen eine Brille brauchen und diese von der Krankenkasse nicht bezahlt wird. âWer keine ZĂ€hne mehr hat, kann immer noch Suppe essen. Aber wenn man nichts mehr sieht, kann man nicht auf die StraĂe und schon gar nicht arbeiten gehen“, sagt sie.
Der Optiker erzĂ€hlt, wie sich das bei ihm dann abspielt. Teilweise kĂ€men Leute herein und sagen, âNachbarn in Not“ bezahlt es. Dann schickt er sie zur KlĂ€rung der Situation zum Sozialamt. Die meisten haben die Notwendigkeit aber vorher mit ihrer Sozialbetreuung abgesprochen, die es wiederum mit âNachbarn in Not“ geklĂ€rt hat. âDann ĂŒberprĂŒfen wir die Augen und suchen entsprechende GlĂ€ser und eine passende Fassung. LuxusausfĂŒhrungen und Extras sind natĂŒrlich nicht möglich.“ Henning Mezger sieht die Aufgabe von âNachbarn in Not’ und seinem Team darin, den Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und ihnen zu helfen, wieder beruflich aktiv zu werden. âMit AktionsglĂ€sern der Grundversorgung kann man schon im tĂ€glichen Leben zurechtkommen“, sagt er. âDie Brillen und das Ausmessen werden komplett von uns gespendet“, erklĂ€rt Henning Mezger sein Konzept. Seit ein paar Jahren macht er das schon. âDa ist schon eine höhere Summe zusammengekommen.“
11.2.2016
Zu viele SchicksalsschlĂ€ge fĂŒr einen
Von Renate LĂŒck
Krank, verspottet und arm - das ist etwas viel fĂŒr einen Menschen. Brigitte K. kĂ€mpft sich durch und âNachbarn in Not“ hilft ein bisschen.
Die 63-JĂ€hrige hat einiges hinter sich, dabei verlief ihr Leben eine gute Strecke fast normal. Vor der Hochzeit arbeitete sie nicht lange. Als sie heiratete, war sie schwanger und ihr Mann meinte, sie solle nun zu Hause bleiben. Drei Kinder zog sie groĂ, bis sie wegen einer Zyste im Bauch ins Krankenhaus musste. Als sie aus der Narkose aufwachte, erklĂ€rten ihr die Mediziner, dass sie auf der anderen Seite noch einen Tumor ausgekratzt hĂ€tten. Sie hatte viel Blut verloren und erhielt anschlieĂend mehrere Chemo-Therapien, weshalb sie alle zwei Wochen ins Krankenhaus musste. Ihr Mann hielt dies fĂŒr Ăbertreibung und kĂŒmmerte sich nicht sonderlich um sie.
Als sie eine finanzielle RĂŒckvergĂŒtung erhielt, die ihr erlaubte, sich eine kleine Wohnung zu suchen, zog sie aus. âDas hat er nicht geglaubt. Er dachte, es stecke ein anderer Mann dahinter. Dabei war ich fix und fertig mit den Nerven.“ Vier Jahre arbeitete sie in einem LebensmittelgeschĂ€ft, bis sich die nĂ€chste Katastrophe anbahnte: Sie hatte wieder Krebs. Doch das begann wieder unauffĂ€llig, zumindest fĂŒr die behandelnden Ărzte. Wegen der Schmerzen in der Nase bekam sie Tabletten und Salbe verschrieben. Als es schlimmer wurde, fuhr sie in eine Spezialklinik. Es wurde ihr Blut abgenommen und konstatiert: âEs ist zum GlĂŒck kein Krebs.“ Mit Tabletten wurde sie heimgeschickt. âMeine Freundinnen konnten das nicht glauben und eine fuhr mich wieder hin mit dem festen Vorsatz: Ich bleibe da, bis sie dich stationĂ€r aufnehmen.“ Man lieĂ sie einige Stunden warten. âDann nahmen sie ohne Narkose eine Probe fĂŒrs Labor und stellten fest: Es ist Krebs.“
Es folgte eine gewaltige Operation, in der bis zur Oberlippe alles weggeschnitten wurde. Provisorisch wurde sie so verbunden, dass sie essen konnte, bis sie eine Prothese bekam. Einige Monate versorgte sie der Sozialdienst, dann wollte die Krankenkasse nicht mehr bezahlen, auch nicht die Fahrten zur Nachuntersuchung. Als sich Brigitte K. das erste Mal im Spiegel ohne Ersatz-Nase sah, war sie entsetzt. Aber dann lernte sie, ihre Prothese selbst zu sĂ€ubern. Inzwischen geht die langsam kaputt und sie mĂŒsste eine neue haben. Aber es graut Brigitte K. davor, wieder abgewiesen zu werden und wieder so viel bezahlen zu mĂŒssen. Denn sie lebt von einer kleinen Erwerbsminderungsrente und etwas Wohngeld. Nun ging auch noch die Waschmaschine kaputt. Nach 15 Jahren funktioniert die ElekÂtronik nicht mehr. Hier konnte âNachbarn in Not“ helfen.
Aus der SZ/BZ vom 28.1.2016
Gutes tun und miteinander teilen
Von Renate LĂŒck
Es war ein schöner Grund fĂŒr Hasso Bubolz, der bis zur Wiederbesetzung des Ortsvorstehers dessen Aufgaben ĂŒbernimmt, ins Rathaus zu kommen: Er ĂŒberreichte zusammen mit Sieglinde Schmidt ein Kuvert mit 1004 Euro an die Vorsitzende von âNachbarn in Not“, Dr. Roswitha Seidel.
Das Geld stammt vom Darmsheimer Adventsmarkt, der seit zwanzig Jahren am Samstag vor dem ersten Advent stattfindet und dessen Erlös immer abwechselnd an die Sindelfinger Hilfsorganisation und den Darmsheimer Krankenpflegeverein gegeben wird. Alle 19 StĂ€nde bekamen ein anonymes Kuvert, in das sie Spenden hineinlegen können. âWir haben noch nie einen leeren Umschlag zurĂŒckbekommen“, erklĂ€rt Hasso Bubolz. Der OrtÂschaftsrat seinerseits sorgt fĂŒr gute Stimmung und groĂen GlĂŒhweinumsatz und stiftet den gesamten Erlös. Sieglinde Schmidt, die gute Seele des Rathauses, die den Adventsmarkt seit vier Jahren organisiert, betont, dass dort keine professionellen Anbieter stehen, sondern nur Privatpersonen, etwa aus den KindergĂ€rten, dem Sportverein und dem Jugendtreff. Sie alle verkaufen Selbstgemachtes. Und sie alle haben ihre Stammkundschaft, die jedes Jahr den Adventsschmuck oder andere Geschenke in Darmsheim holt, obwohl es inzwischen ringsherum noch weitere WeihnachtsmĂ€rkte gibt.
Aus der SZ/BZ vom 1.1.2016
âGutes tun und miteinander teilen“
Von unserer Mitarbeiterin Renate LĂŒck
Es war ein besonderer Gottesdienst sowohl fĂŒr die Neuapostolische Gemeinde Sindelfingen als auch fĂŒr âNachbarn in Not“, denn dank verschiedener AktivitĂ€ten wurden 5.555 Euro fĂŒr die Hilfsorganisation gesammelt, die Bezirksvorsteher Bernhard Kienzle und Gemeinde-Evangelist Dr. Oliver Eberhard an GeschĂ€ftsfĂŒhrerin Brigitte Haug im Januar ĂŒbergaben.
Die Kirche war bei diesem Jugendgottesdienst rappelvoll, denn schon der Projektchor, der am 13. Dezember die Weihnachtskantate von Klaus Heizmann unter der Leitung von Marc Sieger gesungen hatte und nun, dirigiert von Priester Markus SĂŒĂe, Lieder aus dem Gesangbuch prĂ€sentierte, nahm ein Drittel des Raumes ein. Dazu kamen das Orchester, geleitet von Steffi Kunze, und der Kinderchor, der mit Daniela Maxion den Gottesdienst begann. Sowohl bei der AuffĂŒhrung der Kantate im Dezember als auch am Stand der Kinder-Aktiv-Gruppe auf dem Weihnachtsmarkt kamen viele Spenden zusammen.
âHeute ist ein besonderer Tag“, befand deshalb der BezirksĂ€lteste in seiner Predigt und stellte sich vor, wie Menschen in Not, in die sie vielleicht unverschuldet kamen, einsam fĂŒhlen und aus Scham eine Fassade aufbauen. âHinter TĂŒren, an denen man es nicht vermutet.“ Dabei dachte Kienzle nicht nur an die Not von Nachbarn, sondern auch an die groĂe Not auf der Welt, an Hunger und seelische Not und motivierte die Gemeinde mit dem Lied: âKleine Liebesgaben helfen vielen Menschen ĂŒberall im Land.“ Auch der Sindelfinger Priester Heiko MĂŒller und Gemeindevorsteher Achim Maxion freuten sich, dass âdas Sprechzimmer Gottes“ an diesem Tag so voll war. Brigitte Haug, GeschĂ€ftsfĂŒhrerin von âNachbarn in Not“ war ĂŒberwĂ€ltigt von der Summe, die die Gemeinde der Hilfsorganisation fĂŒr ihre Arbeit zur VerfĂŒgung stellte und ĂŒbernahm den Scheck gern.
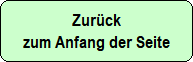
|




 weg und der Mutter sei es peinlich, um etwas zu bitten.
weg und der Mutter sei es peinlich, um etwas zu bitten.